2012 jährt sich die Erstausgabe der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm zum zweihundertsten Male. Ein Grund mehr, um sich die Märchen der Erstausgabe genauer anzusehen.
Ein Märchen, das ich in den folgenden Ausgaben echt vermisse, ist „Die weisse Taube“.
Zum Glück stehen uns heute als Quellen alle Ausgaben der KHM zur Verfügung, z.B. bei ZENO. Auch die vorangegangenen handschriftlichen Aufzeichnungen liegen gedruckt vor, z.B. bei Derungs (2010) 1).
 Ich habe mich seit einiger Zeit mit der erzählreifen Erarbeitung des „Prinz Schwan“ befasst, bis ich zum Schluss kam, dass ich den Prinzen halt Schwan sein lasse. Ich verstehe jetzt auch etwas, weshalb die Brüder Grimm das Märchen aus der Sammlung gekippt haben. Zum Märchentyp ATU 425 („Die Schöne und das Tier“) gibt es ja genügend andere, mehr begeisternde Märchen.
Ich habe mich seit einiger Zeit mit der erzählreifen Erarbeitung des „Prinz Schwan“ befasst, bis ich zum Schluss kam, dass ich den Prinzen halt Schwan sein lasse. Ich verstehe jetzt auch etwas, weshalb die Brüder Grimm das Märchen aus der Sammlung gekippt haben. Zum Märchentyp ATU 425 („Die Schöne und das Tier“) gibt es ja genügend andere, mehr begeisternde Märchen.
Das Märchen scheint eine krude Mischung zahlreicher Motive aus anderen Märchen zu sein, ohne dass diese zu einer geschlossenen Geschichte zusammengewachsen wären. Schon der Beginn ist etwas unvermittelt:
Es war ein Mädchen mitten in einem großen Wald, da kam ein Schwan auf es zugegangen, der hatte einen Knauel Garn, und sprach zu ihm: „ich bin kein Schwan, sondern ein verzauberter Prinz, …..“
Offensichtlich hatten die Brüder Grimm wenig Lust, das Märchen derart tiefgehend zu überarbeiten. Auch sprachlich entspricht es noch nicht dem KHM-Niveau.
Es gibt natürlich noch andere Patchwork-Märchen in den KHM. Aber dort haben die Brüder Grimm jeweils ein geschlossenes Ganzes geschaffen (Bsp. Einäuglein, Zweiäuglein und Dreiäuglein).
1) Derungs, Kurt (Hrsg.), Die ursprünglichen Märchen der Brüder Grimm,
Verlag edition amalia, 2., erweiterte Auflage 2010


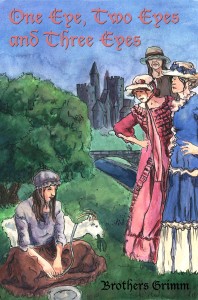




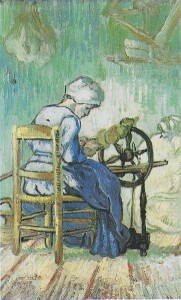 Dieses Märchen hat uns die Märchenerzählerin S. in einer Märchenrunde mit sechs Märchenkolleginnen erzählt in der Version von Rudolf Geiger “Die drei Schwestern der Mutter” . Viele Elemente dieser Betrachtung kristallisierten anschliessend am lauen Maiabend im unserem Garten.
Dieses Märchen hat uns die Märchenerzählerin S. in einer Märchenrunde mit sechs Märchenkolleginnen erzählt in der Version von Rudolf Geiger “Die drei Schwestern der Mutter” . Viele Elemente dieser Betrachtung kristallisierten anschliessend am lauen Maiabend im unserem Garten.