„Ich brauche nicht zu beweisen, dass meine Traumdeutung richtig sei – ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen -, sondern ich muss bloss mit dem Patienten zusammen das Wirksame suchen – beinahe wäre ich versucht zu sagen, das Wirkliche.“ (C.G. Jung)
“Der Traum, der nicht interpretiert wird, gleicht einem Brief, der nicht gelesen wird.” …
“Ein Traum ist eine Miniatur-Prophezeiung”
(Rabbi Hisda, Babylonischer Talmud, Berachot 55a)
Was ist Wirklichkeit ?
„Ich habe letzte Nacht geträumt, ich sei ein Schmetterling. Jetzt weiss ich nicht, ob ich ein Mensch bin, der träumt, er sei ein Schmetterling, oder ob ich vielleicht ein Schmetterling bin, der jetzt träumt, er sei ein Mensch.“ (Chinesischer Dichter)
Beitrag über Träume in Märchen >>.
Spätestens seit den Arbeiten C.G. Jungs ist es deutlich geworden, dass Märchen und Träume dieselbe Sprache sprechen. Die von Jung begründete „Komplexe oder Analytische Psychologie“ geht davon aus, dass es ein “kollektives Unbewusstes” gibt, das sich in Träumen und Märchen symbolhaft spiegelt.

Beim Thema Traum und beim Thema Märcheninterpretation kommen wir um die beiden grossen Psychoanalytiker des 20. Jhdts., um Sigmund Freud und Carl Gustav Jung nicht herum. (links bzw. rechts vorne auf der Photographie). Deshalb sollen sie in den folgenden Gedanken auch ausführlich gewürdigt werden (immer mit dem Vorbehalt, dass ich ein Märchen-Mensch und nicht ein Psychologieexperte bin). Wichtig ist aber auch der Beitrag von Erich Fromm, der eine Synthese der Gedanken Freuds und Jungs versuchte und mit seiner eigenen humanistischen Sozialpsychologie verband.
Meiner Auffassung von Märchen kommen allerdings Jung’s Theorien wesentlich mehr entgegen.
Vergleich von Märchen und Traum
Märchen richten sich an alle Menschen, indem sie wichtige Wahrheiten über das Leben und Hilfen und Zuversicht für den Lebensweg jedes Menschen anbieten. Natürlich immer im Kleid und Schmuck der Kultur, in welcher das Märchen überliefert wird. Märchen sind der reinste und einfachste Ausdruck kollektiv-unbewusster psychischer Prozesse. Das Märchen selbst ist seine eigene beste Erklärung. Seine Bedeutung ist in der Gesamtheit seiner Motive, die durch den Handlungsfaden verbunden sind, enthalten. Nach C.G. Jung ist das zentrale Thema des Märchens „Das Selbst“, im Sinne der psychischen Gesamtheit eines Menschen und gleichzeitig als Regulationszentrum des kollektiven Unbewussten.
„Jung hat festgestellt, dass Märchen verschiedener Kulturen sehr viel gemeinsam haben. Die seelischen Tiefenschichten, die sich sowohl in Märchen wie auch in Träumen Ausdruck verschaffen, stellen ein Feld dar, das uns mit allen Menschen verbindet. Die Märchen sind für Jung ein Spiegel, in dem wir unser eigenes Leben mit seinen verschiedenen Stationen, seinen Wünschen, seinen Kämpfen und Auseinandersetzungen gespiegelt finden und an dem wir uns orientieren können. Die Muster betreffen wirklich unser Leben.“ (Pater Bruno Lautenschlager in einem Interview)
Träume sind eher etwas persönliches, auf das Leben des einzelnen zugeschnitten, auch wenn sie die Bildsprache des kollektiven Unbewussten verwenden. Marie-Louise von Franz beobachtete: Wenn man sich mit Märchen intensiv befasst und nicht überzeugt ist, alles verstanden zu haben, kommen einem Träume zu Hilfe. Das Unbewusste reagiert folglich sogar auf die Märchen. Jolande Jacobi schrieb: “Wir vermögen die Mythen und Märchen, die wir im Wachsein lesen, im Traum zu erleben, wie wenn sie wirklich wären, …”
Verena Kast in einem Vortrag über C.G. Jung: „So ist es möglich, in Traumbildern, die für uns ganz persönlich bedeutsam sind, die auch mit Strukturelementen angereichert sind, die nur aus unserer persönlichen Lebensgeschichte heraus verstehbar sind (Komplexe), auch Grundstrukturen, Bilder zu finden, und damit auch Emotionen, die in der Geschichte der Menschheit gekannt, immer wieder thematisiert und dargestellt worden sind. Dies entspricht der Idee, dass wir Menschen eben typisch menschliche Schwierigkeiten, typisch menschliche Bilder, Erlebnismöglichkeiten, Emotionen, Verhaltensweisen kennen, die allerdings auch von der je eigenen individuellen Erlebens- und Verhaltensweise, aber auch von der gesellschaftlichen Situation, der Zeitgeschichte, in der wir leben, überlagert sind. Wir sind also immer auch mehr als unsere Lebensgeschichte.“
Das Märchen stellt meiner Ansicht nach gerade dieses typisch Menschliche losgelöst vom Individuellen (und auch losgelöst von konkreter Zeit und Geographie dar).
Eine symbolische Geschichte ereignet sich in Raum und Zeit, aber muss nicht unseren Gesetzen von Raum und Zeit gehorchen. Die Abfolge ist zwar sequentiell, aber nicht in unserem Sinne logisch, obwohl eine fast zwingend erscheinende verborgenene Logik („latente Logik“ bei E. Fromm) besteht, die uns in den Märchen immer wieder überrascht.
Ich würde die Gedanken der Schule C.G. Jungs zu Träumen und Märchen vereinfacht so zusammenfassen:
Märchen sind ein Ausdruck kollektiv-unbewusster psychischer Prozesse. Träume sind ein Ausdruck individuell-unbewusster psychischer Prozesse. Beide verwenden dieselbe Bildsprache des kollektiven Unbewussten.
Jung selber war sich sicher, dass auch in den Träumen Wissen aus dem Kollektiven auftauchen. Wie soll man sonst die Wirkung von Träumen als Ratgeber oder gar prophetische Träume verstehen? Jung sieht im Traum eine umfassendere Manifestation des Unbewussten, in der sich sowohl Vergangenes wie auch Zukünftiges zeigen können. Für Jung verfügt das Unbewusste sogar eine „Intelligenz und Zweckgerichtetheit …., welche der zur Zeit möglichen bewussten Einsicht überlegen sind.“ Jung sagt auch, dass dem Menschen nicht durch das, was er selbst denkt, geholfen werde, sondern durch die Offenbarung einer Weisheit, die grösser sei als seine eigene. Dies deckt sich sehr stark mit der heute sich (wieder) verbreitenden Erkenntnis, dass alles Wissen eigentlich schon vorhanden sei.
Jung wird allerdings insofern etwas einseitig, als er den Bezug zum aktuellen seelischen Leben des Träumers vernachlässigt.
Nur unter Berücksichtigung der Gegenwart wird der Traum zu einer Kraft, die das „angezapfte“ Wissen nutzen kann.
Während wir schlafen, geben wir uns nicht damit ab, die Aussenwelt unseren Zwecken zu unterwerfen. Aber wir sind auch frei, befreit von den meisten Alltagslasten und befreit von den Gesetzen von Raum und Zeit. Das „Ich bin“ kommt zum Zuge. Wenn wir schlafen ist uns die Welt des Tages, die sogenannte Realität ebenso unbewusst wie uns im Wachzustand die Innenwelt ist (siehe chinesisches Zitat am Anfang).
 Wenn wir wach sind müssen die Inhalte unseres Denkens nicht zwingend den Gesetzen von Raum und Zeit unterworfen sein (Phantasien, Gedanken zu Vergangenheit und Zukunft), aber die beim Denken verwendeten Kategorien sind es. Die Gedanken können Bilder verwenden, die völlig verständlich, aber nicht raum-zeit-logisch sind. Wir denken dann „als ob“. Der Traum aber kennt kein „als ob“.
Wenn wir wach sind müssen die Inhalte unseres Denkens nicht zwingend den Gesetzen von Raum und Zeit unterworfen sein (Phantasien, Gedanken zu Vergangenheit und Zukunft), aber die beim Denken verwendeten Kategorien sind es. Die Gedanken können Bilder verwenden, die völlig verständlich, aber nicht raum-zeit-logisch sind. Wir denken dann „als ob“. Der Traum aber kennt kein „als ob“.
Erich Fromm (Bild rechts) sagt: Wir sind in unseren Träumen nicht nur „weniger vernünftig und anständig“, sondern genau so oft auch klüger, urteilsfähiger und sozialer als im Wachen. Im Zustand des Schlafes tritt das Schlechteste und zugleich das Beste in uns in Erscheinung.
In unserem normalen Leben treten oft Ziele in den Vordergrund, die im Widerspruch zu denen des wahren Selbst stehen. Unsere höchste Energie, die Liebeskraft kommt nicht zum Zuge, so dass man z.B. Macht über andere zu gewinnen sucht. Die innere Sicherheit geht verloren und man sucht einen Ausgleich, indem man nach Ruhm und Ansehen im Äusseren strebt. Diese Feststellung Fromms ist nicht nur ein Exposé für Träume, sondern essentiell auch für Märchen!
Freud und Jung
 Sigmund Freud betrachtet ja die Träume sehr stark als Ausdruck unerfüllter Wünsche aus einer mehr oder weniger unbewussten Mangelsituation heraus.
Sigmund Freud betrachtet ja die Träume sehr stark als Ausdruck unerfüllter Wünsche aus einer mehr oder weniger unbewussten Mangelsituation heraus.
Und das Märchen? Das Märchen kennt immer Mangelsituationen, und oft ist es ein Wunsch, der weiterhilft. Die Wünsche werden im Märchen meistens früher oder später erfüllt, auch die törichten Wünsche! Die Wünsche beinhalten also bereits die Umsetzung, sie sind so gut wie Wirklichkeit. Das Märchen wird sozusagen zum Paradigma des Mentaltrainings. Das führt uns zur Auffassung C.G. Jungs (siehe oben).
Freud nimmt an, dass der Traum unbewusste Strebungen zum Ausdruck bringt, deren Gewahrwerden wir uns nicht gestatten und die wir daher aus unserem Bewusstsein fernhalten, solange wir unsere Gedanken voll unter Kontrolle haben. Diese verdrängten Gedanken und Gefühle werden im Schlaf lebendig und finden eine Ausdrucksmöglichkeit in den Träumen. Die unser Traumleben motivierenden Kräfte sind unsere irrationalen Wünsche. Freud nimmt an, dass diese Wünsche im „normalen“ Leben unterdrückt werden. Sie tauchen in der Nacht auf, wenn die Kontrolle fehlt. Freud sucht die Wurzeln die der irrationalen Wünsche (und daher auch des Traumes ) in der Kindheit eines Menschen, in der noch „alles erlaubt“ war, also keine Moral Zensur übte. Dementsprechend erschien Freud das Ausleben dieser Träume als unvereinbar mit der erwachsenen Persönlichkeit eines Menschen.
Freud sieht als Konsequenz in den Märchen eine Regression auf frühere Stufen der Menschheitsentwicklung. Die Befriedigung libidinöser Wünsche wird in Geschichten im Reich der Phantasie gesucht.
C.G. Jungs Auffassung zu Märchen und Traum habe ich oben dargestellt.
Erich Fromm versucht eine Synthese von Freud und Jung, indem er die aktuelle Lebenssituation des Träumers miteinbezieht. Die Träume erhalten bei Fromm eine revolutionäre Komponente für die Persönlichkeitsentwicklung, indem sie einerseits die innere Zensur für die unbewussten Vorgänge des Individuums und anderseits die Verblendung durch die Gesellschaftsstrukturen überwinden.
Fromm vertritt die „Ansicht, dass Träume sowohl an unserer irrationalen als auch an unserer rationalen Natur teilhaben und dass es das Ziel der Kunst der Traumdeutung ist, zu erkennen, wann unser besseres Selbst und wann unserer tierische Natur sich im Traum vernehmen lässt.“ Man sollte zu erkennen versuchen, „ob ein Traum einen irrationalen Wunsch, eine schlichte Furcht oder Angst oder eine Einsicht in innere oder äussere Kräfte und Ereignisse zum Ausdruck bringt.“ Es ist auch zu fragen, „in welcher Beziehung der Traum zu jüngsten Ereignissen … und zu dessen Gesamtpersönlichkeit, zu seinen Ängsten und Wünschen steht, die in seinem Charakter wurzeln.“
Interpretation von Träumen und Märchen
Wenn ich mit der Intuition eine Märchendeutung versuche, erfasse ich folglich das Märchen am umfassendsten, nicht nur als schöne, mit Symbolen gespickte Geschichte, sondern als Botschaft, aufgespalten in viele Facetten.
Ergänzend dazu kann ich ein Märchen auf der Ebene der Strukturen und Motive (wie z.B. Aarne und Thompson) betrachten, sie im Kontext der Werte und Kulturen sehen und die Symbole gefühlsmässig wahrnehmen.
Wissenschaftlich an ein Märchen heranzugehen heisst, vorurteilslos daran zu gehen. Feste Vorstellungen, was Symbole bedeuten, sind Vorurteile.
 Auch der Traum bringt immer eine neue Botschaft und spiegelt nicht die bekannten Themen. Am Märchen kann man Vorurteilslosigkeit üben, weil dort nicht konkrete Themen eines Individuums, für welche möglicherweise eine persönliche Angstblockade besteht, sondern allgemein Menschliches behandelt wird.
Auch der Traum bringt immer eine neue Botschaft und spiegelt nicht die bekannten Themen. Am Märchen kann man Vorurteilslosigkeit üben, weil dort nicht konkrete Themen eines Individuums, für welche möglicherweise eine persönliche Angstblockade besteht, sondern allgemein Menschliches behandelt wird.
Bei der Deutung von Träumen und Märchen warnt Marie-Louise von Franz in ihrem Buch „Psychologische Märcheninterpretation“ davor, sofort intellektuell-analytisch vorzugehen: Wenn in einem Traum ein Adler zum Fenster herein fliegt, denkt man nicht zuerst an seine mythologische Bedeutung (z.B. als Bote Gottes), was wissenschaftlich völlig richtig wäre, sondern es ist primär ein Erlebnis mit Emotionen. Und warum war es ein Adler und nicht ein Engel? Mythologisch macht das keinen grossen Unterschied, aber für den Träumer schon, weil ganz andere Emotionen und Assoziationen damit verbunden werden. Deshalb greift eine intellektuell-wissenschaftliche Betrachtungsweise in der Traumdeutung immer viel zu kurz. Der wichtigste Faktor ist der Boden, auf welchem so ein Traum wächst, die menschliche Grundlage, aus der solche Motive entstehen.
Aus Analogie zur Traumdeutung heisst das für mich, meinen „Boden“, auf welchem ich an ein Märchen herangehe, als Ausgangspunkt zu nehmen.
Traumforscher weisen darauf hin, dass es in einem Traum manchmal zu einer Aufspaltung einer Person in zwei Personen kommt, der Träumer sich in zwei verschiedenen Rollen sieht. Analogie im Märchen: Wenn wir mit der sogenannten subjektstufigen Betrachtungsweise an ein Märchen herangehen, verstehen wir die verschiedenen Personen (einschliesslich der Tiere und übernatürlichen Wesen) als verschiedene Aspekte der Hauptperson, mit denen diese sich in ihrem Leben auseinandersetzen muss.
Symbolsprache der Träume und Märchen
Erich Fromm, der ursprünglich Sigmund Freuds Auffassung näher steht und später eine Synthese der Auffassungen von Freud und Jung versucht, sagt: “Wenn die symbolische Sprache (der Märchen und Träume) eine eigenständige Sprache, die tatsächlich einzige universelle „Weltsprache“ ist, die alle Menschen, Kulturen und Religionen verbindet, geht es darum, sie zu verstehen, nicht zu deuten, wie wenn es ein künstlich hergestellter Geheimcode wäre. … Ich halte die Symbolsprache für die einzige Fremdsprache, die jeder von uns lernen sollte.”
Die Symbolsprache der Träume fasst Freud als Geheimcode auf, mit dem der Zensor inn unserer Persönlichkeit überlistet werden sollte. Entsprechend dem hohen Stellenwert der inzestuösen Sexualität bei Freud, sind für ihn die Traumsymbole Symbole für Sexualorgane und Vater und Mutter.
 Das Märchen „des Kaisers neue Kleider“, ein Kunstmärchen von H.C. Andersen interpretiert Freud entsprechend als Darstellung unserer exhibitionistischen Wünsche. Freud verkennt die offensichtliche Botschaft, dass unsere Neigung, Autoritätspersonen und andere Idole mit wunderbaren Eigenschaften auszustatten oder uns von ihnen blenden zu lassen, erst durch ein unbefangenes, ehrliches Sehen entlarvt wird, die reine Sicht eines Kindes.
Das Märchen „des Kaisers neue Kleider“, ein Kunstmärchen von H.C. Andersen interpretiert Freud entsprechend als Darstellung unserer exhibitionistischen Wünsche. Freud verkennt die offensichtliche Botschaft, dass unsere Neigung, Autoritätspersonen und andere Idole mit wunderbaren Eigenschaften auszustatten oder uns von ihnen blenden zu lassen, erst durch ein unbefangenes, ehrliches Sehen entlarvt wird, die reine Sicht eines Kindes.
Jung lehnt natürlich Freuds Vorstellung ab, dass Träume ein „Täuschungsmanöver“ unseres Ichs und die Symbole ein „Überlistungscode“ seien.
Für Fromm ist die Symbolsprache eine Sprache, in der die Aussenwelt ein Symbol der Innenwelt, ein Symbol unserer Seele, unseres Geistes ist. Er unterscheidet
- Konventionelle Symbole, bei welche in Zusammenhang zwischen dem Symbol und dem Gegenstand nicht ersichtlich ist, z.B. das Lautbild oder Schriftbild. Wir lernen den Zusammenhang durch Bilden einer Assoziation. Vielleicht sind solche konventionellen Symbole ursprünglich direkter mit dem Gegenstand verknüpft gewesen, wie das heute bei onomatopoetischen Wörtern noch der Fall sein kann. Beispiel: Das Aussprechen des Wortes „Pfui“ ist mit einer physischen Geste des Abscheus verbunden. Wohl kein Zufall, dass es hier um den Ausdruck eines Gefühls geht, nicht um die Beschreibung eines Gegenstandes. Neben den Wörtern gibt es andere konventionellen Symbole: die Fahne eines Landes, obwohl viele Fahnen ursprünglich eine konkrete, in der Regel mythische Bedeutung für das Land hatten, die heute nicht mehr direkt nachvollziehbar sondern einfach eine Assoziation ist.
- Zufällige Symbole entstehen durch die Verbindung von emotionalen Erlebnissen mit Gegenständlichem. Wenn ich auf der Nordfriesischen Insel Föhr einmal eine ruhevolle, von schönen Stimmungen geprägte Zeit erlebt habe, wird Föhr für mich ein Symbol für diese Gefühle bleiben. Das nutzt z.B. die Werbung aus. Wenn mich in der Stadt XY meine Geliebte verlassen hat, wird die Stadt XY ein Symbol für enttäuschte Liebe bleiben und jedesmal ein „Blues“-Gefühl hervorrufen, da meine damaligen Gefühle mit dieser Stadt verbunden bleiben werden. Es entsteht also eine Assoziation zwischen einem Gefühl und etwas Gegenständlichem. Zufällige Symbole bleiben persönlich, jemand anders kann in derselben Stadt XY völlig andere Gefühle erlebt, vielleicht die Frau seines Leben gefunden haben.
- Universelle Symbole werden von vielen Menschen geteilt. Es besteht eine innere Beziehung zwischen dem Symbol und dem, was es repräsentiert. Es ist in der Erfahrung vieler Menschen verwurzelt, auch wenn es kulturell sehr verschieden ausgeprägt sein kann. Gewisse Symbole sind wirklich universell, so dass sie von allen Menschen geteilt werden, wie zum Beispiel „Das Feuer“, das überall mit Begriffen wie Kraft, Energie, Transformation usw. verbunden wird, wobei wir je nach persönlicher Gefühlslage und kultureller Herkunft Unterschiedliches assoziieren.
Erscheinungen der physischen Welt sind Symbole für Zustände und Ereignisse in unserem Inneren. Unsere Seele drückt sich ja auch sonst im Physischen aus, z.B. indem Emotionen in Körperreaktionen umgesetzt werden (Bsp.: Erröten, Schaudern, Gesichtsausdrücke, Gesten). So wird unser Körper selber zu einem Symbol. Solche Symbole müssen wir nicht „lernen“.
 Bei gewissen universellen Symbole ist die kulturelle Einbettung sehr ausgeprägt. Zum Beispiel: „Die Sonne“ hat für eine Kultur, in welcher „zuviel“ Sonne Dürre und Missernte zur Folge haben und damit das Überleben gefährden (das Wasser gilt hier wohl eher als lebensspendend) kann eine ganz andere Dynamik als für eine nordische Kultur, wo Wasser genügend vorhanden ist, und dafür das Überleben von genügend Sonneneinstrahlung abhängig ist, und die Wintersonnenwende ein wichtiges Ereignis darstellt. (Bild links: Hethitisches Sonnensymbol)
Bei gewissen universellen Symbole ist die kulturelle Einbettung sehr ausgeprägt. Zum Beispiel: „Die Sonne“ hat für eine Kultur, in welcher „zuviel“ Sonne Dürre und Missernte zur Folge haben und damit das Überleben gefährden (das Wasser gilt hier wohl eher als lebensspendend) kann eine ganz andere Dynamik als für eine nordische Kultur, wo Wasser genügend vorhanden ist, und dafür das Überleben von genügend Sonneneinstrahlung abhängig ist, und die Wintersonnenwende ein wichtiges Ereignis darstellt. (Bild links: Hethitisches Sonnensymbol)
Adolf Bastian postulierte in der Mitte des 19. Jhdts. die „Elementargedanken“, die jedem Menschen angeboren sind und sich dann ganz unterschiedlich in den Volksgedanken manifestieren. Diese Elementargedanken sind eine Anfangsstufe zum Archetypen-Konzept C.G. Jungs. Bastian beschränkte seine Vorstellung noch auf Gedanken im intellektuellen Sinne, ohne die Dimensionen des Fühlens, Erfahrens usw. dazuzunehmen. Diese von Volk zu Volk unterschiedlich dargestellten Elementargedanken finden wir natürlich auch in den Märchen wieder. Sagen und Mythen sind stärker kulturabhängig als Märchen. Daher spiegeln sie die Grundmuster der menschlichen Seele weniger klar.
Die Archetypen sind seelische Strukturen im Unbewussten, die sich uns in Bildern und Verhaltenmustern auf archaische Weise zeigen. Entsprechend ihres Ursprungs in der menschlichen Entwicklung als Urerfahrungen deuten sie auf grundlegend Menschliches wie Kampf zwischen Gut und Böse, Liebe usw. Im Unbewussten sind alle Archetypen miteinander verbunden und überlappen sich. Das hat nach Marie-Louise von Franz mit der Zeit- und Raumlosigkeit der Archetypen zu tun.
Als Märchenerzähler sehe ich auch die Märchen mit ihren typischen Anfängen in dieser Zeit- und Raumlosigkeit „angesiedelt“.
[Fortsetzung/Abschluss folgen]


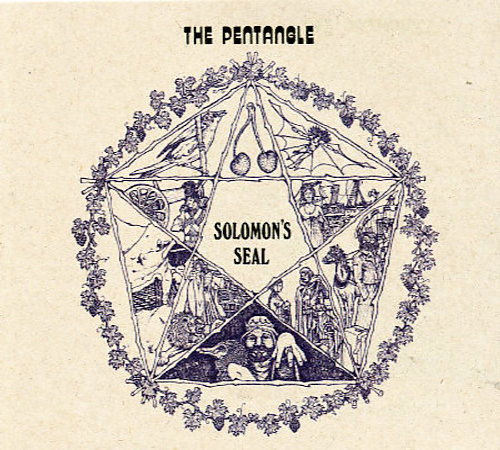

 Ein heiliger Affe zog einst in die Berge des Himalayas, um zu meditieren.
Ein heiliger Affe zog einst in die Berge des Himalayas, um zu meditieren.
 für die
für die 