Für die Märchenstubete vom 23.05.2008 habe ich eine Betrachtung zum Märchentyp AT 710 “Our Lady’s Child” oder “Die Patin” verfasst.
Einige Gedanken zum Märchentyp “Our Lady’s Child”.
Manches stammt aus den Notizen zum Symposium “Das Geheimnis der Patin”, veranstaltet 15.-17. Juni 2007 von der Schweizerischen Märchengesellschaft in Einsiedeln. Einiges auch aus Gesprächen mit meiner Ehepartnerin Ingrid Gauer.
Die drei Märchen, die ich an diesem Abend in der ersten Hälfte erzählt habe, gehören alle zum selben Mächentyp. Die offizielle Bezeichnung (ATU 710) lautet: “Our Lady’s Child”, also das Kind unserer Frau, wobei mit Lady natürlich eine mächtige und hochstehende Frau gemeint ist. Andere Bezeichnungen für diesen Märchentyp sind “Das Geheimnis der Patin”, “Die schwarze Madonna” oder einfach nach dem Titel des Märchens bei den Brüdern Grimm “Marienkind”: Der rote Faden in diesem Märchentyp ist in der Regel:
- Tochter eines armen Mannes wird von einer mächtigen Frau aufgenommen.
- Mädchen hat es gut und erhält Zugang zu allem.
- Es gibt eine Tür, die Tabu ist und ein Geheimnis birgt, etwas Grossartiges oder Ungeheuerliches, worüber das Mädchen später nicht reden darf oder kann.
- Nach dem Brechen des Tabus (in der Pubertät oder Adoleszenz) muss sie den Ort der mächtigen Frau verlassen, wird meist stumm und schliesslich von einem König aufgenommen und geheiratet.
- Sie bringt mehrere Kinder zur Welt. In der ersten Nacht erscheint immer die mächtige Frau, fragt sie nach dem Tabubruch.
- Die Königin gesteht nicht oder verrät nichts, und die Frau nimmt ihr das Kind.
- Die Königin kommt als Kindsfresserin auf den Scheiterhaufen.
- Die mächtige Frau erscheint noch einmal. 2 Varianten: Die Königin gesteht endlich und wird erlöst (christliche Variante) oder sie bleibt verschwiegen und erlöst durch ihre Standhaftigkeit nicht nur sich sondern oft auch die mächtige Frau.
- Kinder zurück, Sprache zurück, Happy End.
Diese Märchen wecken natürlich eine ganze Reihe von Assoziationen und werfen viele Fragen auf. Zum Handlungsablauf fragen wir uns zum Beispiel:
Vom kulturellen Hintergrund her würden wir auch gerne wissen:
Und das führt uns zurück zur Frage:
zurück auf die Veranstaltungsseite >
Wieso bricht das Mädchen das Verbot ?
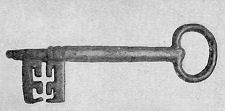 In allen Märchen hat das Mädchen den Zugang, den Schlüssel zum verbotenen Zimmer. Es ist also zwangsläufig, dass sie das Verbot übertritt, obwohl sie damit ihr bequemes Leben im Paradies aufs Spiel setzt. Sie soll auf ihrem Entwicklungsweg die letzten grossen Geheimnisse erfahren, auch wenn sie damit Tabus und Verbote bricht. Es geht um den für sie entscheidenden Entwicklungsschritt.
In allen Märchen hat das Mädchen den Zugang, den Schlüssel zum verbotenen Zimmer. Es ist also zwangsläufig, dass sie das Verbot übertritt, obwohl sie damit ihr bequemes Leben im Paradies aufs Spiel setzt. Sie soll auf ihrem Entwicklungsweg die letzten grossen Geheimnisse erfahren, auch wenn sie damit Tabus und Verbote bricht. Es geht um den für sie entscheidenden Entwicklungsschritt.
Dass sie den Schlüssel auch zum verbotenen Zimmer erhält, ist meines Erachtens nicht eine Prüfung, ob sie das Verbot befolgen kann, sondern umgekehrt: sie erhält das Verbot als Prüfung, ob sie sich getraut auch die letzte Wahrheit zu erkunden.
Typisch ist, dass dies meist im Alter von 14 Jahren geschieht, zu einer Zeit, wo früher die Mädchen nicht nur biologisch sondern auch gesellschaftlich zur Frau wurden.
Der Rausschmiss aus dem Paradies ist der Beginn einer neuen Lebensphase als junge Frau. Und der König, der sie heiratet, lässt nicht lange auf sich warten. Der Abschluss dieser Entwickung (Initiation) kann allerdings erst nach einigen harten Prüfungen erfolgen ……..
Zurück zum Anfang>
Weshalb leugnet beziehungsweise verschweigt die junge Frau ?
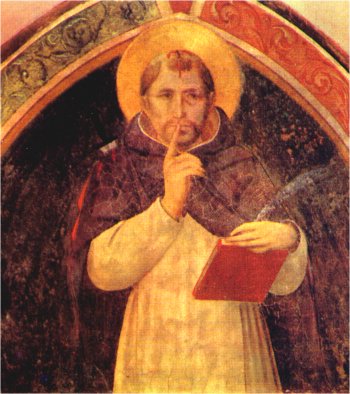 Das standhafte Schweigen ist angesichts der Bedrohung (Kinder weg, Scheiterhaufen) vordergründig kaum nachvollziehbar.
Das standhafte Schweigen ist angesichts der Bedrohung (Kinder weg, Scheiterhaufen) vordergründig kaum nachvollziehbar.
Mögliche Verständnisfäden:
Das Wissen, das sie durch ihre verbotene Aktion erhält, ist kulturgeschichtlich gesehen nicht “Allgemeinwissen” sondern “Geheimwissen”. Und nur durch Verschwiegenheit, selbst wenn man ihr die eigenen Kinder wegnimmt, oder unter Todesdrohung, erweist sie sich würdig, einen Schritt zur Höherentwicklung (Erlösung) tun zu können.
In der Neuzeit wurde dieses Wissen im Prinzip allen Menschen zugänglich gemacht (Christentum, Islam, fernöstliche Religionen; auch wenn das die institutionalisierten Kirchen nicht gerade fördern). In unserem Märchen braucht es aber “einiges”, bis Marienkind am Ende zu ihrer Erfahrung stehen kann (gesteht). > siehe weiter unten
Zurück zum Anfang>
Wer ist denn diese mächtige Frau ?
Die Forschung hat zweifelsfrei ergeben, dass es sich bei der “Lady” um die grosse Göttin oder zumindest eine hohe Priesterin der grossen Göttin handelt. Mit der grossen Göttin meine ich die allmächtige, mit weiblichen Attributen ausgestatte Gottheit, die vor dem Übergang zum patriarchalischen Gottesbegriff verehrt wurde als Versuch, sich die höchste Macht und Energie vorzustellen.

Typisch ist ihre starke Verbindung mit der Erde und der Natur, damit auch der Fruchtbarkeit und Ernährung. Die Farben schwarz (Erd-Farbe) und grün (Natur) werden oft dafür gebraucht. Die hoch verehrten schwarzen Madonnen (z. B. Chartres, Le-Puy-en-Velay, Einsiedeln) oder die Madonnen in grünen, mit Kornähren verzierten Kleidern zeugen davon, dass diese Aspekte auch im Christentum weiterleben (siehe Bilder auf der Veranstaltungseite). Auch die ihr Kind stillenden Madonnen haben natürlich diese nährenden Aspekte.
Dieses Schwarz soll uns ferner daran erinnern, dass auch das Dunkle nichts anderes als göttliche Energie ist (Diese dunklen Gottesaspekte stehen für uns heute im religiösen Leben eher abgespalten im Hintergrund oder werden einem Gegenspieler von Gott [Teufel] zugeschrieben).
Eine weitere starke Verbindung der grossen Göttin besteht zum Wasser und zu den nächtlichen Gestirnen, also Mond und Sternen, hier kommen blau und silbern als Farben dazu. “Himmelblau”, “Wasserblau” und “Nacht” sind nicht nur häufige allgemeine weibliche Attribute sondern auch ins Christentum übernommen in den zahllosen Darstellungen der Maria als blau gekleidete Mondkönigin oder mit einer Sternenkrone.
Eine andere wichtige Farbabstufung im Zusammenhang mit der weiblichen Göttlichkeit ist die Reihe weiss – rot – schwarz:
- Weiss steht für die hellen, lichten Aspekte, aber auch für die kindliche Reinheit und Ganzheit. Die jungfräuliche Maria hat diese Aspekte der grossen Göttin geerbt. Diese hellen Lichtaspekte stehen für uns heute im religiösen Leben eher im Vordergrund.
- Rot steht für die junge, reife Frau, für physisches Leben und Sinnlichkeit. Wir erinnern uns an das rote Kleid des Marienkinds, nachdem es aus dem Paradies geschmissen wurde.
- Schwarz steht für die weise alte Frau, die vor ihrem physischen Ende steht. Gleichzeitig ist sie aber auch die Verderbende, denn nur so kann der Zyklus von Wiedergeburt, Leben und Tod aufrecht erhalten werden. In diesem Sinne könnte man die Erlösung der schwarzen Frau zur weissen als Bild für Tod und Wiedergeburt interpretieren.
Psychologisch gesehen bedeutet die Erlösung der schwarzen Frau vielleicht die Rehabilitation der weiblichen Göttlichkeit, welche in den patriarchalischen Religionen eingeschwärzt wurde.
Eine Interpretation dieser Erlösung auf geistiger Ebene könnte sein, dass im göttlichen Schöpfungsplan letztlich alles Dunkle, auch die dunklen Aspekte des Göttlichen, zu Licht werden.
Wichtige Autorinnen und Forscherinnen auf diesem Gebiet sind Ingrid Riedel und Heide Göttner-Abendroth , die eine ganze Reihe von Büchern um das Thema der grossen Göttin verfasst haben. Ein ausführlicher Beitrag von Ingrid Riedel findet sich auch im > Internet .
Zurück zum Anfang>
Was wird in dem Märchen eigentlich beschrieben ?
Ich möchte mir in keiner Weise anmassen, das Märchen zu verstehen oder als Gesamtes deuten zu können. Vielmehr sehe ich ein Gewebe von verschiedenen Sinnsträngen und damit verbundenen Aussagen.
Der erste Teil des Märchens beschreibt ursprünglich vermutlich die Initiation eines Mädchens, durch welche es ins eigentliche Leben als junge Frau geworfen wird. Es kommt zu einer hochgestellten Frau, die sie “Zimmer für Zimmer” ins Leben einführt, wobei das Mädchen eigentlich völlig auf sich selbst gestellt ist. Die Prozesse dieser Entwicklungszeit muss eben jeder Mensch individuell durchmachen; Erwachsenwerden ist ein Erfahrungs-, kein Lehrbuchwissen.
Von der Religion her betrachtet gibt es in vielen Märchen dieses Typs Hinweise, dass es sich auch um die Beschreibung einer Initiation zu einer Priesterin handelt (schamanistische Symbole) (vergleiche dazu Kurt Derungs : Vortrag am oben erwähnten Symposium).
Im zweiten Teil erfolgt dann die Bewährung, die Schweigepflicht, denn in den alten Mysterienkulturen war ein grosser Teil der Erkenntnis des Göttlichen ein Geheimwissen.
In den meisten heutigen Religionen besteht diese Schweigepflicht nicht mehr. Es geht um das Bekennen (also in der Sprache des Märchens um das Gestehen). Im “Marienkind” wäre das Bekennen gefordert, aber die Gotteserfahrung, welche das Mädchen im verbotenen Zimmer macht, ist zu gewaltig, als dass sie das so locker bekennen könnte, auch nicht gegenüber der Maria, die hier nebenbei gesagt sehr streng und gar nicht milde auftritt.
Und immer wieder begegnet die junge Frau ihrer Vergangenheit bei der Lady und wird damit mit deren Geheimnissen konfrontiert, bis sie diese integrieren kann.
Diese Integration ist zugleich ihre Erlösung.
Zur Erlösung der mächtigen Frau: > siehe oben
Zurück zum Anfang>

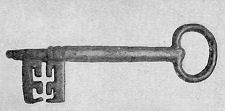 In allen Märchen hat das Mädchen den Zugang, den Schlüssel zum verbotenen Zimmer. Es ist also zwangsläufig, dass sie das Verbot übertritt, obwohl sie damit ihr bequemes Leben im Paradies aufs Spiel setzt. Sie soll auf ihrem Entwicklungsweg die letzten grossen Geheimnisse erfahren, auch wenn sie damit Tabus und Verbote bricht. Es geht um den für sie entscheidenden Entwicklungsschritt.
In allen Märchen hat das Mädchen den Zugang, den Schlüssel zum verbotenen Zimmer. Es ist also zwangsläufig, dass sie das Verbot übertritt, obwohl sie damit ihr bequemes Leben im Paradies aufs Spiel setzt. Sie soll auf ihrem Entwicklungsweg die letzten grossen Geheimnisse erfahren, auch wenn sie damit Tabus und Verbote bricht. Es geht um den für sie entscheidenden Entwicklungsschritt.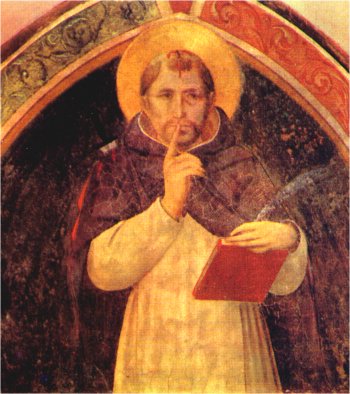 Das standhafte Schweigen ist angesichts der Bedrohung (Kinder weg, Scheiterhaufen) vordergründig kaum nachvollziehbar.
Das standhafte Schweigen ist angesichts der Bedrohung (Kinder weg, Scheiterhaufen) vordergründig kaum nachvollziehbar.
